
Die Kinder von Korogocho
Inhaltsverzeichnis
Besonders an einem Weltkindertag wie heute: Wenn wir an einen Slum denken, tauchen oft sofort Bilder von Elend auf. Doch um Korogocho zu verstehen, muss man sich einen ganz bestimmten Ort vorstellen: Dandora, eine der größten offenen Müllhalden Afrikas, die direkt an den Slum grenzt.
Es ist ein riesiges, dampfendes Areal, auf dem täglich Tonnen von Abfall abgeladen werden. Das Schockierendste daran: Bis zu 60 Prozent der Kinder aus Korogocho gehen regelmäßig dorthin, um im Müll nach etwas zu suchen, dass sie verkaufen können – das ist oftmals die einzige Einkommensquelle für Familien.
Im Müll nach Essen suchen
Aber nicht nur das. In „Boma“, wie diese gigantische Müllkippe von den Einheimischen genannt wird, geht es auch ums Essen. Es geht um Nahrung, ums Überleben. Einer der Slumbewohner, mit dem ich dort war, berichtete mir: „Hier habe ich den ersten Hamburger meines Lebens gegessen.“ und lächelte dabei. „War lecker, hat wirklich gut geschmeckt.“
Dies ist der Ausgangspunkt, der Hintergrund, vor dem sich das Leben hier abspielt – ein Ort, der für viele das Ende der Hoffnung symbolisiert.
"Wo Wunder geschehen"
Doch dann gibt es diese andere Seite von Korogocho, dem drittgrößten Slum in Kenias Hauptstadt Nairobi. Ausgerechnet dieser Ort, dessen Name in der Sprache der Kikuyu so viel wie „Chaos“ oder „Durcheinander“ bedeutet, hat sich einen überraschenden Ruf erworben.
Er wird von Thomas Schwarz als der „Slum, in dem Wunder geschehen“ bezeichnet. Schwarz, Journalist und Buchautor, beschreibt diese Wunder nicht als „übernatürlichen Ereignisse“, sondern als „das Ergebnis menschlicher Widerstandsfähigkeit“, das von den Bewohnern Korogochos selbst angetrieben werde. Schwarz hat den Slum unzählige Male seit 2007 bis heute besucht.
Zum Weltkindertag: Vier überraschende Lektionen aus Korogocho
Dieser Beitrag beleuchtet vier der überraschendsten und wirkungsvollsten Lektionen, die wir aus den beeindruckenden Initiativen lernen können, die im Herzen von Korogocho wachsen. Sie erzählen eine Geschichte nicht von Verzweiflung, sondern von Eigeninitiative, Einfallsreichtum und der tiefen Überzeugung, dass Veränderung möglich ist.
In Korogocho ist Elektrizität weit mehr als nur eine Annehmlichkeit – sie ist ein fundamentaler Baustein für jede Form von Perspektive. Wenn die Nacht hereinbricht, verwandelt sich jede Gasse in eine Zone der Unsicherheit, das Risiko von Überfällen und Gewalt steigt.
Für unzählige Kinder endet der Lerntag abrupt, denn ohne Licht ist es unmöglich, Hausaufgaben zu machen oder für Prüfungen zu lernen. Auch die lokale Wirtschaft erstickt in der Dunkelheit: Ein Barbier kann seine Haarschneidemaschine nicht benutzen, eine Näherin ihre Nähmaschine. Ganz zu schweigen von plötzlich nötiger Hilfe in einem Notfall.
Ohne Strom keine Perspektive
In dem Versuch, diesem Mangel zu entkommen, greifen viele Bewohner auf improvisierte, illegale Stromanschlüsse zurück. Diese stellen eine ständige Gefahr dar und führen immer wieder zu Bränden und tödlichen Stromschlägen. Doch hier verbirgt sich eine grausame wirtschaftliche Falle: Diese unsicheren Anschlüsse kosten oft ein Vielfaches mehr als die offizielle Versorgung.
Gleichzeitig ist die Anschaffung einer sicheren Alternative wie einer Solarlampe für die meisten Familien unerschwinglich. Dieser Teufelskreis zementiert die Armut. Die Situation verdeutlicht eine brutale Wahrheit: wo es keine Energie gibt, gibt es oft keine Perspektive.
Diese Lektion aus Korogocho zwingt uns, unsere Wahrnehmung von Grundversorgung neu zu definieren. Eine einfache Glühbirne ist hier kein Luxus, sondern ein entscheidender Faktor, der über Bildung, Sicherheit und die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens entscheidet.
Wichtigste Werkzeug für Veränderung: Nicht Geld, sondern ein Fußball
Vor über 15 Jahren hatte Hamilton Ayiera Nyanga, ein junger Mann aus Korogocho, eine Idee. Er hatte gerade für Kenia beim Homeless World Cup gespielt und kam mit 1500 Euro Preisgeld zurück – ein Vermögen in einem Umfeld, in dem der Tagesverdienst oft unter zwei Euro liegt. Statt das Geld für sich zu nutzen, gründete er die Ayiera-Initiative. Sein Credo, auf Zettel an Holzzäunen geschrieben: „A ball can change slum“. Ein Fußball kann den Slum verändern.
Diese Idee wurde zum Funken für eine ganze Bewegung. Hamilton wusste, dass Fußball Jugendliche wie ein Magnet anzieht. Aber für ihn war es nie nur ein Spiel. Es war ein Werkzeug zur Friedensstiftung („Conflict Prevention“), das verfeindete ethnische Gruppen wie die Luo und Kikuyu und andere in gemeinsamen Teams zusammenbrachte. Es war eine bewusste Alternative zu einem Leben auf der Straße, das von Kriminalität, Drogenmissbrauch und Gewalt bedroht ist.
Sie helfen sich zuerst selbst
Heute folgen viele diesem Vorbild. Initiativen wie die Machinani League und Teds Community Hub nutzen den Sport, um Gemeinschaft zu stiften. Die Trainer werden zu Mentoren, zu vertrauenswürdigen Ansprechpartnern. Sie schaffen einen sicheren Raum, in dem Jugendliche „über Dinge sprechen können, die sie zu Hause vielleicht nicht besprechen können oder wollen“.
Der Fußball dient dabei oft als „Köder“, Magnet, Motivation. Bei Teds Hub beispielsweise geht es nicht nur um das Kicken. Hier erhalten Hunderte von Kindern jeden Samstag eine warme Mahlzeit und haben Zugang zu einer kleinen Bibliothek. Der Fußball öffnet die Tür zu Bildung und sozialer Unterstützung. Julius Tamree hat die Mashinani League mit nur 17 Jahren gemeinsam mit Freunden gestartet – ohne jede Hilfe von außen. Da war er fast noch ein Kind.
Er fasst den Geist dieser Bewegungen in einem einfachen Satz zusammen: „I love my hood“, in ihrer eigenen Sprache, dem Swahili, heißt das: „Ya mtaa!“. Und ein Musikstück – inklusive Video dazu – gibt es natürlich auch.
Aus Müll wird Zukunft: Die stillen Helden der Nachbarschaft
Die Entstehungsgeschichte der Wakulima Youth Group ist vielleicht die eindrucksvollste Lektion aus Korogocho. Alles begann mit einer denkbar einfachen Idee. Eine junge Frau von vielleicht 16, 17 Jahren schlug ihren Freunden vor, „etwas zu tun, anstatt nur herumzuhängen“. Ihre erste Handlung: Sie säuberten gemeinsam einen schmutzigen Korridor zwischen den Wellblechhütten.
Zusätzlich betreiben sie ein kleines Hühnerprojekt, um die Gemeinschaft mit Eiern zu versorgen. Und natürlich auch, um damit etwas Geld zu verdienen – das sie dann wieder in ihr Projekt stecken können.
In einem Umfeld, das vom benachbarten Müllberg Dandora geprägt ist, war diese Tat ein Akt des Trotzes. Es war die Weigerung, sich von Dreck und Unordnung definieren zu lassen. Aus diesem kleinen Funken entstand eine Bewegung. Ohne jegliche externe Starthilfe begann die Gruppe, vernachlässigte Flächen, die als Müllhalden dienten, in kleine Grünflächen zu verwandeln.
Sie entwickelten ein nachhaltiges Modell: Sie sammeln Müll auf der Straße, etwa Plastik und Metall, reinigen und verkaufen ihn, um mit dem Erlös Werkzeuge zu kaufen. Zusätzlich betreiben sie ein kleines Hühnerprojekt, um die Gemeinschaft mit Eiern zu versorgen. Und natürlich auch, um ein paar davon zu verkaufen. Damit verdienen sie dann Geld, das sie wiederum in ihr Projekt stecken können.
Durch ihre sichtbaren Taten wandelte sich die Wahrnehmung dieser Kinder und Jugendlichen grundlegend. Wo sie früher vielleicht als untätig oder sogar als potenzielle Unruhestifter galten, sind sie heute Vorbilder. Ihre Geschichte zeigt auf beeindruckende Weise, dass die wirkungsvollste Veränderung dann geschieht, wenn die Leute die Verantwortung für ihre unmittelbare Umgebung selbst übernehmen – und aus Müll eine Zukunft schaffen.
Die wirksamsten Lösungen wachsen von unten, nicht von oben
Fasst man die Lektionen aus Korogocho zusammen, kristallisiert sich eine übergeordnete Erkenntnis heraus: Echte und nachhaltige Entwicklung wird von den Bewohnern selbst vorangetrieben. Die unzähligen kleinen Initiativen – man könnte sie „Grassroots-NGOs“ nennen. Oder, angelehnt an Wirtschafts-Deutsch auch NGO-„Startups“ – stellen das traditionelle Modell der Entwicklungshilfe, bei dem Lösungen in fernen Konferenzräumen entworfen werden, radikal in Frage.
Diese lokalen Organisationen entstehen aus einem tiefen, gelebten Verständnis für die tatsächlichen Bedürfnisse der Gemeinschaft. Sie sind nicht das Ergebnis von Analysen aus der Ferne, sondern die Antwort auf reale, alltägliche Herausforderungen. Angetrieben von einem starken Gemeinschaftsgefühl und dem unbedingten Willen zur Veränderung, beweisen sie eine Effektivität, die externe Programme oft nur schwer erreichen. Die Stimmen der Bewohner selbst bestätigen diese Wirkung am deutlichsten.
Die Wunder von Korogocho
Diese „Wunder“ von Korogocho sind keine übernatürlichen Ereignisse. Sie sind das Ergebnis menschlicher Widerstandsfähigkeit, von Einfallsreichtum und kollektivem Handeln angesichts überwältigender Widrigkeiten. Die Geschichten von einem Fußball, der Frieden stiftet, einer Glühbirne, die Bildung ermöglicht, und einer Gruppe Jugendlicher, die eine Müllhalde in einen Garten verwandelt, sind kraftvolle Zeugnisse dafür, was möglich ist, wenn Menschen die Dinge selbst in die Hand nehmen.
Die Erfahrungen aus diesem Slum werfen eine grundlegende, nachdenkliche Frage auf, die uns alle betrifft: „Schauen wir bei der Suche nach Lösungen immer in die richtige Richtung?“ Vielleicht fordert uns das Beispiel von Korogocho heraus, unsere Vorstellungen von Entwicklung neu zu denken – weg von externen Interventionen und hin zur Stärkung der unglaublichen Kraft, die in den Gemeinschaften selbst liegt.
Diese Schlussfolgerung bedeutet natürlich nicht, dass wir aus den reichen Teilen der Welt sie nicht (mehr) unterstützen sollten. Im Gegenteil: Gerade solche Selbsthilfe-Initiativen haben es verdient. Da werden die Spenden in Hühner investiert oder in ein Kind, dass damit die Schule besuchen kann. Das „Wunder von Korogocho“ ist ausgesprochen ansteckend …
Ähnliche Beiträge


Weitere Artikel

Made in China | Diktatur, Folter, Kerker
9 Feb. 2019
Flüchtlinge | Das erschütternde Versagen der EU
5 März 2020
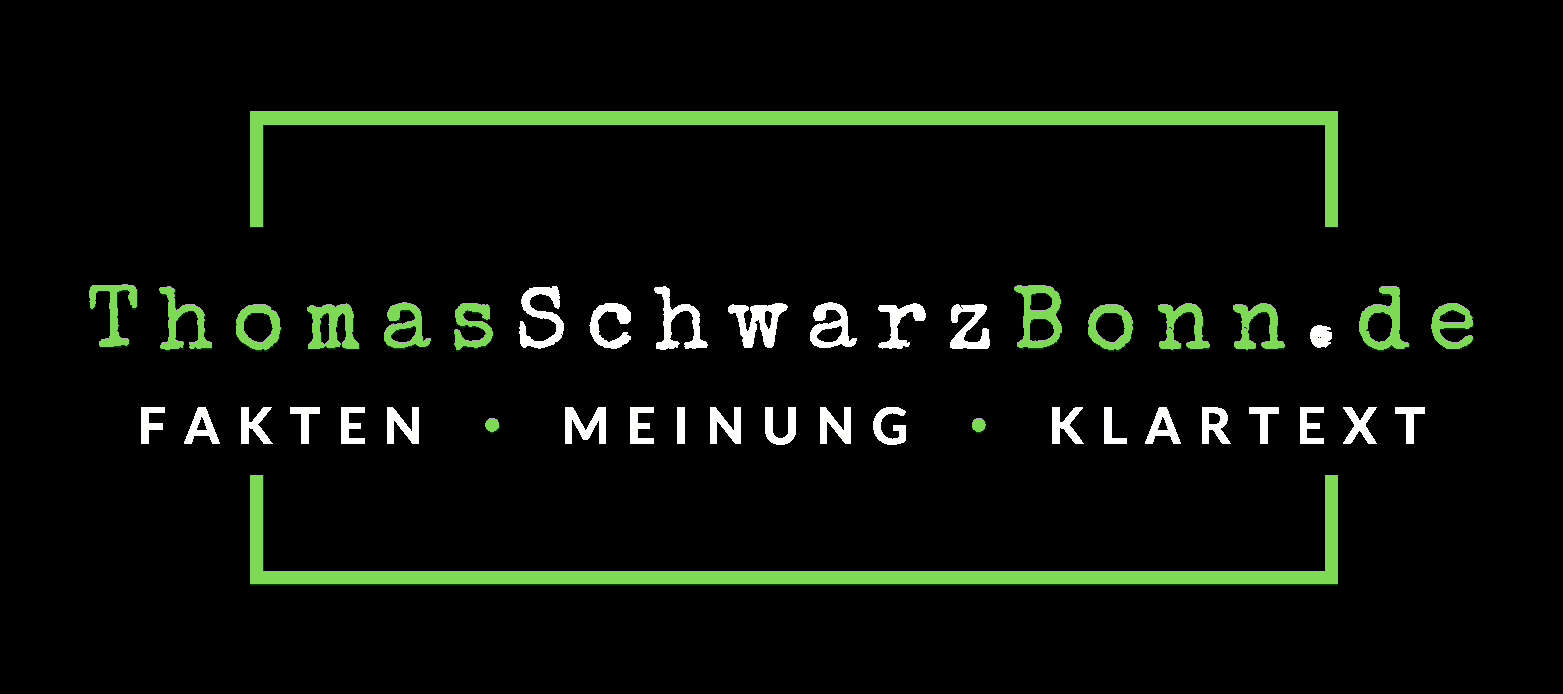







Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.